Ende Zweiter Weltkrieg – Schriftsteller Ian Buruma: „Jede Nation hat ihre Mythen“
2025-05-02T13:37:00Z
 Ende Zweiter Weltkrieg – Schriftsteller Ian Buruma: „Jede Nation hat ihre Mythen“
Drucken Teilen
US-amerikanische Soldaten überqueren im März 1945 die Brücke von Remagen. © Upi/picture alliance / dpa
Der Schriftsteller Ian Buruma über den langen Schatten des Zweiten Weltkriegs,
über Kollaborateure und was man von ihnen über die heutige Zeit lernen kann
Ein Interview von Daniel Bax
Ein Gespräch mit Ian Buruma, der sich mit den Folgen des Zweiten Weltkriegs ausführlich beschäftigt hat.
Herr Buruma, wie hat Ihr Vater das Ende des Zweiten Weltkriegs erlebt?
Er war als junger Mann aus den Niederlanden nach Berlin verschleppt und als Zwangsarbeiter in einer Fabrik für Eisenbahnbremsen eingesetzt worden. 1943 waren die meisten jungen deutschen Männer an der Front waren, und Deutschland brauchte dringend Fabrikarbeiter. In vielen Ländern unter deutscher Besatzung wurden junge Männer deshalb dafür zwangsrekrutiert. Mein Vater war damals ein Student. Viele seiner Kommilitonen gingen in den Untergrund und versteckten sich, so auch mein Vater. Aber etwas ging schief, und so endete er in Berlin.
Hat er sich deshalb wie ein Kollaborateur gefühlt?
Ich habe seine Briefe aus jener Zeit gelesen. Er war sich der Tatsache bewusst, dass er nicht zum Widerstandskämpfer geboren war – und, dass viele zu Hause deshalb auf ihn herabschauen und ihn verurteilen würden. Wenn man unter deutscher Besatzung lebte, dann war jeder Deutsche ein Bösewicht und Feind, denn sie waren meistens in der SS oder der Wehrmacht und die Besatzer. Aber mein Vater hat in Berlin unter gewöhnlichen Deutschen gelebt, die wie er den alliierten Bomben ausgesetzt waren. Er hat die Deutschen nicht verklärt, und er hegte schon gar keine Sympathien für das Nazi-Regime. Aber er hatte auch anständige Deutsche kennengelernt. Das hat seine Weltsicht geprägt.
Sie haben mehrere Bücher über den Zweiten Weltkrieg und seine Nachwehen geschrieben, darunter zuletzt ein Buch über drei berühmte Kollaborateure. Warum?
Ich habe mich immer für das Thema interessiert – aus historischen und aus psychologischen Gründen. Ich wurde im Schatten des Zweiten Weltkriegs geboren, im Dezember 1951. Die große moralische Frage, die in meiner Kindheit in den Niederlanden vorherrschte, war: standen die Leute im Krieg auf der richtigen oder der falschen Seite? Das Bild war komplett schwarz-weiß, die Grauzonen rückten erst viel später in den Blick. Aus einer literarischen und psychologischen Perspektive interessiere ich mich außerdem mehr dafür, warum Menschen böse Dinge tun, als warum sie gute Dinge tun. Ich finde Helden und Heilige etwas langweilig.
Warum das?
Als selbstkritischer Mensch stellt man fest, dass die Versuchungen, schlechte Dinge zu tun, oft sehr groß sind. Deshalb finde ich es interessanter, darüber nachzudenken, warum Menschen falsche Entscheidungen treffen. Alle drei Charaktere waren aber nicht nur Kollaborateure im klassischen Sinne, die mit verbrecherischen Regimes kollaborierten. Sie waren auch Hochstapler, die um sich herum einen Mythos kreierten.
Sie porträtieren in Ihrem Buch Himmlers finnischen Masseur Felix Kersten, den jüdisch-orthodoxen Autor Friedrich Weinreb aus den Niederlanden, der über seine Vergangenheit log, sowie die in Japan aufgewachsene Mandschu-Prinzessin, Spionin und Cross-Dresserin Kawashima Yoshiku. Was verbindet deren Geschichten?
Mir gefällt es, ähnliche Geschichten aus unterschiedlichen nationalen und kulturellen Perspektiven zu erzählen. Ich habe einmal ein Buch darüber geschrieben, wie Japaner und Deutsche mit ihrer Vergangenheit umgehen („Erbschaft der Schuld“, d. Red.). In diesem Fall habe ich etwas ähnliches versucht. Denn ich denke, jenseits aller großen kulturellen Unterschiede gibt es so viele verbindende universelle Themen, in denen man eine gemeinsame Humanität erkennt. Viele Leute sagen: oh, die Kulturen sind so unterschiedlich, man kann sie nicht vergleichen. Doch, das kann man. Es geht mir auch nicht darum, die Kulturen zu vergleichen, sondern festzustellen, was das gemeinsame Menschsein ausmacht.
Diese Menschen lebten zur Zeit des Zweiten Weltkriegs in Diktaturen. Welchen Bezug haben ihre Biografien zu unserer heutigen Zeit?
In den drei größten Weltmächten unserer Zeit – China, Russland und die USA – sind Lügen Teil der Politik geworden. Trump lügt genauso viel wie Putin, und seinen Anhängern ist das egal. Das Gleiche gilt für China: das Regime lügt die ganze Zeit. Die USA sind noch eine Demokratie, aber die Lüge gewinnt auch hier in der Politik immer mehr Raum. Das untergräbt die Demokratie. Sobald sich der Eindruck verfestigt, dass es keine verbindlichen Wahrheiten mehr gibt, sondern alles eine Frage von Partikularinteressen ist, dann wird alles zu Propaganda. Und wenn man alles für Propaganda hält, dann kann eine Demokratie nicht mehr funktionieren. Das ist etwas, das Hitler und Goebbels sehr gut verstanden haben. Damit müssen wir uns in Demokratien genauso auseinandersetzen wie Menschen, die in Diktaturen leben – wenn auch auf eine andere Weise, natürlich.
Wo sehen Sie die Parallelen zur heutigen Zeit?
Trump ist ein Außenseiter mit kriminellen Neigungen, kein Politiker. Er möchte die etablierten demokratischen Institutionen zerstören, die Rechtsstaatlichkeit und die Gewaltenteilung. Mit sich hat er jede Menge Leute gebracht, die der Sorte Mensch ähneln, die unter Diktaturen aufsteigen: Wütendes Mittelmaß, voller Ressentiments und Rachegefühlen gegenüber einer sogenannten Elite, die erfolgreicher ist als sie selbst. Darunter sind Spieler, Betrüger, Kriminelle – alle möglichen Leute, die normalerweise am Rand der Gesellschaft stehen. Das Nazi-Regime war voll von solchen Leuten. Nehmen Sie jemanden wie Joachim von Ribbentrop, der in den Zwanzigerjahren ein Champagner-Verkäufer war. Unter normalen Umständen wäre er niemals Außenminister geworden. Natürlich ist Trump nicht Hitler, und die Vereinigten Staaten unter ihm sind nicht das Dritte Reich. Aber das Faszinierende und Beängstigende an Trumps Amerika ist, dass solche Leute plötzlich an die Spitze gespült wurden.
Woran liegt das?
Wir leben heute in einer Zeit, in der das ganze Konzept von Wahrheit in Frage gestellt wird. Politiker lügen dreist, und vielen Menschen ist das egal. Die ganze Idee von „Wahrheit“ ist relativ geworden und wird nicht nur durch rechtspopulistische Politiker in Zweifel gezogen. Auch linke akademische Zirkel und postmoderne Theorien tragen zu dem Eindruck bei, dass Wahrheit in Wirklichkeit nur Machtverhältnisse spiegelt und damit alles relativ ist.
In vielen Ländern unter deutscher Nazi-Besatzung war nur eine Minderheit im Widerstand. War Kollaboration die Norm?
In den meisten Ländern, die unter deutscher Besatzung standen, gab es statistisch gesehen rund zehn Prozent, die aktiv Widerstand leisteten, in manchen etwas mehr. Ungefähr genauso viele haben aktiv kollaboriert. Der Rest hat versucht, sein Leben zu leben, sich die Hände nicht allzu schmutzig zu machen und in die andere Richtung geschaut.
Wo verläuft die Grenze zwischen Anpassung, Opportunismus und aktiver Kollaboration?
Das ist eine gute Frage, die mich sehr interessiert hat: Wie weit bist du gezwungen oder bereit, Kompromisse einzugehen mit einem Regime, von dem du weißt, dass es kriminell ist? Wie weit gehst du? Diese Frage stellt sich, fürchte ich, nicht nur in Diktaturen, sondern auch in Ländern, die noch demokratisch sind. Ich hoffe, dass meine Furcht unberechtigt ist.
Der Zweite Weltkrieg ist jetzt 80 Jahre vorbei. Leben wir noch in seinem Schatten?
Für die junge Generation ist er Geschichte geworden. Es sind nicht länger Anekdoten, die sie von ihren Eltern oder Großeltern am Abendtisch hören. Aber es war so eine traumatische Zeit, dass die Erinnerungen daran nie ganz verblassen werden: Denken Sie nur an die vielen Filme, die bis heute über den Zweiten Weltkrieg gedreht werden. Und auch seine Folgen wirken nach. Er ist auf eine Art und Weise zu einem Bezugspunkt für unsere heutigen moralischen Werte und Maßstäbe geworden wie wenig anderes.
Gilt das nur für Europa und die USA oder auch für den Rest der Welt?
Der Zweite Weltkrieg hat nicht viele Länder unberührt gelassen. Und in Asien sind die Erinnerungen an den Zweiten Weltkrieg noch gegenwärtig, vielleicht sogar noch mehr als in Europa. Denn in Ländern wie Südkorea oder Südostasien herrscht das Gefühl vor, dass sich Japan nicht wirklich mit dem Erbe des Krieges auseinandergesetzt hat. Die Wunden dort heilen noch langsamer. In den Niederlanden gibt es heute keine ernsthaften Vorbehalte gegenüber Deutschland mehr. In Südkorea und China gibt es dagegen noch eine Menge Vorbehalte gegen Japan. Diese Emotionen sind da, und sie werden manchmal auch für politische Zwecke angefacht.
In den Niederlanden war die Abneigung gegen Deutsche nach dem dem Zweiten Weltkrieg sehr ausgeprägt.
Gegen Deutschland zu sein wurde nach dem Zweiten Weltkrieg ein Teil der niederländischen Identität – so, wie es bis heute Teil der polnischen Identität ist, gegen Russland zu sein. Aber in den Niederlanden ist das jetzt Vergangenheit. Junge Leute sind heute nicht mehr so antideutsch eingestellt, wie es meine Generation noch war. Berlin gilt als cool, und es macht niemandem mehr etwas aus, wenn Deutschland im Fußball gewinnt. Uns dagegen machte das damals sehr viel aus: wir sahen in Lothar Matthäus einen Wiedergänger der Nazis (lacht).
Das ist heute vorbei?
Heute muss man neue Dinge finden, um seine Identität zu artikulieren. Das ist heute viel komplizierter. Da kommen dann etwa die Muslime ins Spiel.
Die Niederlande waren im Krieg ein Opfer der Deutschen. Hat das verhindert, sich mit der eigenen kolonialen Vergangenheit auseinanderzusetzen?
Jede Nation hat ihre Mythen, die es ihnen erlauben, sich stolz zu fühlen. In manchen Fällen, wie in China, ist es ihre alte Zivilisation. In anderen, wie in Frankreich, sind es kulturelle Leistungen. In den Niederlanden ist es das Gefühl, anderen Nationen moralisch überlegen zu sein. Das ist ein sehr protestantisches Konzept. Und es macht es schwerer, sich den dunklen Kapiteln der eigenen Geschichte zu stellen.
Ist die Debatte um den „Zwarte Piet“ dafür ein Symptom? Diese Figur mit Wulstlippen und krausem Haar begleitet in Holland traditionell den Nikolaus. Viele Niederländer wehren sich gegen die Vorstellung, er könnte etwas mit dem Kolonialismus zu tun haben.
Dabei hat es alles mit Kolonialismus zu tun! Konservative sagen immer: aber wir lieben den Zwarte Piet, er ist so eine positive Figur! Das stimmt, aber er knüpft auch an das Stereotyp vom „Naturvolk“ an. Er tanzt, macht lustige Grimassen und ist immer fröhlich. Diese Vorstellung vom „Naturvolk“ hat auch in Deutschland bis weit nach dem Zweiten Weltkrieg überdauert. Klar wurden diese Menschen bewundert – aber aus den falschen Gründen.
Soll man den Zwarte Piet abschaffen oder reformieren?
Ich bin ganz auf der Seite derjenigen, die sagen, dass das eine altmodische Tradition ist, die in der heutigen Welt keinen Platz mehr haben sollte. Er ruft zu viele schlechte Assoziationen hervor. Es ist auch keine sehr alte Tradition: sie stammt, wie so vieles, aus dem 19. Jahrhundert. Denn wenn sie sich Abbildungen des heiligen St. Nikolaus aus den 17. Jahrhunderts anschauen, dann finden sie dort keinen „Zwarte Piet“.
Dennoch hängen viele Niederländer am „Zwarte Piet“?
Zwischen den Städten und den Provinzen gibt es eine Kluft. Aber in den großen Städten ist der „Zwarte Piet“ weitgehend abgeschafft worden.
Ende Zweiter Weltkrieg – Schriftsteller Ian Buruma: „Jede Nation hat ihre Mythen“
Drucken Teilen
US-amerikanische Soldaten überqueren im März 1945 die Brücke von Remagen. © Upi/picture alliance / dpa
Der Schriftsteller Ian Buruma über den langen Schatten des Zweiten Weltkriegs,
über Kollaborateure und was man von ihnen über die heutige Zeit lernen kann
Ein Interview von Daniel Bax
Ein Gespräch mit Ian Buruma, der sich mit den Folgen des Zweiten Weltkriegs ausführlich beschäftigt hat.
Herr Buruma, wie hat Ihr Vater das Ende des Zweiten Weltkriegs erlebt?
Er war als junger Mann aus den Niederlanden nach Berlin verschleppt und als Zwangsarbeiter in einer Fabrik für Eisenbahnbremsen eingesetzt worden. 1943 waren die meisten jungen deutschen Männer an der Front waren, und Deutschland brauchte dringend Fabrikarbeiter. In vielen Ländern unter deutscher Besatzung wurden junge Männer deshalb dafür zwangsrekrutiert. Mein Vater war damals ein Student. Viele seiner Kommilitonen gingen in den Untergrund und versteckten sich, so auch mein Vater. Aber etwas ging schief, und so endete er in Berlin.
Hat er sich deshalb wie ein Kollaborateur gefühlt?
Ich habe seine Briefe aus jener Zeit gelesen. Er war sich der Tatsache bewusst, dass er nicht zum Widerstandskämpfer geboren war – und, dass viele zu Hause deshalb auf ihn herabschauen und ihn verurteilen würden. Wenn man unter deutscher Besatzung lebte, dann war jeder Deutsche ein Bösewicht und Feind, denn sie waren meistens in der SS oder der Wehrmacht und die Besatzer. Aber mein Vater hat in Berlin unter gewöhnlichen Deutschen gelebt, die wie er den alliierten Bomben ausgesetzt waren. Er hat die Deutschen nicht verklärt, und er hegte schon gar keine Sympathien für das Nazi-Regime. Aber er hatte auch anständige Deutsche kennengelernt. Das hat seine Weltsicht geprägt.
Sie haben mehrere Bücher über den Zweiten Weltkrieg und seine Nachwehen geschrieben, darunter zuletzt ein Buch über drei berühmte Kollaborateure. Warum?
Ich habe mich immer für das Thema interessiert – aus historischen und aus psychologischen Gründen. Ich wurde im Schatten des Zweiten Weltkriegs geboren, im Dezember 1951. Die große moralische Frage, die in meiner Kindheit in den Niederlanden vorherrschte, war: standen die Leute im Krieg auf der richtigen oder der falschen Seite? Das Bild war komplett schwarz-weiß, die Grauzonen rückten erst viel später in den Blick. Aus einer literarischen und psychologischen Perspektive interessiere ich mich außerdem mehr dafür, warum Menschen böse Dinge tun, als warum sie gute Dinge tun. Ich finde Helden und Heilige etwas langweilig.
Warum das?
Als selbstkritischer Mensch stellt man fest, dass die Versuchungen, schlechte Dinge zu tun, oft sehr groß sind. Deshalb finde ich es interessanter, darüber nachzudenken, warum Menschen falsche Entscheidungen treffen. Alle drei Charaktere waren aber nicht nur Kollaborateure im klassischen Sinne, die mit verbrecherischen Regimes kollaborierten. Sie waren auch Hochstapler, die um sich herum einen Mythos kreierten.
Sie porträtieren in Ihrem Buch Himmlers finnischen Masseur Felix Kersten, den jüdisch-orthodoxen Autor Friedrich Weinreb aus den Niederlanden, der über seine Vergangenheit log, sowie die in Japan aufgewachsene Mandschu-Prinzessin, Spionin und Cross-Dresserin Kawashima Yoshiku. Was verbindet deren Geschichten?
Mir gefällt es, ähnliche Geschichten aus unterschiedlichen nationalen und kulturellen Perspektiven zu erzählen. Ich habe einmal ein Buch darüber geschrieben, wie Japaner und Deutsche mit ihrer Vergangenheit umgehen („Erbschaft der Schuld“, d. Red.). In diesem Fall habe ich etwas ähnliches versucht. Denn ich denke, jenseits aller großen kulturellen Unterschiede gibt es so viele verbindende universelle Themen, in denen man eine gemeinsame Humanität erkennt. Viele Leute sagen: oh, die Kulturen sind so unterschiedlich, man kann sie nicht vergleichen. Doch, das kann man. Es geht mir auch nicht darum, die Kulturen zu vergleichen, sondern festzustellen, was das gemeinsame Menschsein ausmacht.
Diese Menschen lebten zur Zeit des Zweiten Weltkriegs in Diktaturen. Welchen Bezug haben ihre Biografien zu unserer heutigen Zeit?
In den drei größten Weltmächten unserer Zeit – China, Russland und die USA – sind Lügen Teil der Politik geworden. Trump lügt genauso viel wie Putin, und seinen Anhängern ist das egal. Das Gleiche gilt für China: das Regime lügt die ganze Zeit. Die USA sind noch eine Demokratie, aber die Lüge gewinnt auch hier in der Politik immer mehr Raum. Das untergräbt die Demokratie. Sobald sich der Eindruck verfestigt, dass es keine verbindlichen Wahrheiten mehr gibt, sondern alles eine Frage von Partikularinteressen ist, dann wird alles zu Propaganda. Und wenn man alles für Propaganda hält, dann kann eine Demokratie nicht mehr funktionieren. Das ist etwas, das Hitler und Goebbels sehr gut verstanden haben. Damit müssen wir uns in Demokratien genauso auseinandersetzen wie Menschen, die in Diktaturen leben – wenn auch auf eine andere Weise, natürlich.
Wo sehen Sie die Parallelen zur heutigen Zeit?
Trump ist ein Außenseiter mit kriminellen Neigungen, kein Politiker. Er möchte die etablierten demokratischen Institutionen zerstören, die Rechtsstaatlichkeit und die Gewaltenteilung. Mit sich hat er jede Menge Leute gebracht, die der Sorte Mensch ähneln, die unter Diktaturen aufsteigen: Wütendes Mittelmaß, voller Ressentiments und Rachegefühlen gegenüber einer sogenannten Elite, die erfolgreicher ist als sie selbst. Darunter sind Spieler, Betrüger, Kriminelle – alle möglichen Leute, die normalerweise am Rand der Gesellschaft stehen. Das Nazi-Regime war voll von solchen Leuten. Nehmen Sie jemanden wie Joachim von Ribbentrop, der in den Zwanzigerjahren ein Champagner-Verkäufer war. Unter normalen Umständen wäre er niemals Außenminister geworden. Natürlich ist Trump nicht Hitler, und die Vereinigten Staaten unter ihm sind nicht das Dritte Reich. Aber das Faszinierende und Beängstigende an Trumps Amerika ist, dass solche Leute plötzlich an die Spitze gespült wurden.
Woran liegt das?
Wir leben heute in einer Zeit, in der das ganze Konzept von Wahrheit in Frage gestellt wird. Politiker lügen dreist, und vielen Menschen ist das egal. Die ganze Idee von „Wahrheit“ ist relativ geworden und wird nicht nur durch rechtspopulistische Politiker in Zweifel gezogen. Auch linke akademische Zirkel und postmoderne Theorien tragen zu dem Eindruck bei, dass Wahrheit in Wirklichkeit nur Machtverhältnisse spiegelt und damit alles relativ ist.
In vielen Ländern unter deutscher Nazi-Besatzung war nur eine Minderheit im Widerstand. War Kollaboration die Norm?
In den meisten Ländern, die unter deutscher Besatzung standen, gab es statistisch gesehen rund zehn Prozent, die aktiv Widerstand leisteten, in manchen etwas mehr. Ungefähr genauso viele haben aktiv kollaboriert. Der Rest hat versucht, sein Leben zu leben, sich die Hände nicht allzu schmutzig zu machen und in die andere Richtung geschaut.
Wo verläuft die Grenze zwischen Anpassung, Opportunismus und aktiver Kollaboration?
Das ist eine gute Frage, die mich sehr interessiert hat: Wie weit bist du gezwungen oder bereit, Kompromisse einzugehen mit einem Regime, von dem du weißt, dass es kriminell ist? Wie weit gehst du? Diese Frage stellt sich, fürchte ich, nicht nur in Diktaturen, sondern auch in Ländern, die noch demokratisch sind. Ich hoffe, dass meine Furcht unberechtigt ist.
Der Zweite Weltkrieg ist jetzt 80 Jahre vorbei. Leben wir noch in seinem Schatten?
Für die junge Generation ist er Geschichte geworden. Es sind nicht länger Anekdoten, die sie von ihren Eltern oder Großeltern am Abendtisch hören. Aber es war so eine traumatische Zeit, dass die Erinnerungen daran nie ganz verblassen werden: Denken Sie nur an die vielen Filme, die bis heute über den Zweiten Weltkrieg gedreht werden. Und auch seine Folgen wirken nach. Er ist auf eine Art und Weise zu einem Bezugspunkt für unsere heutigen moralischen Werte und Maßstäbe geworden wie wenig anderes.
Gilt das nur für Europa und die USA oder auch für den Rest der Welt?
Der Zweite Weltkrieg hat nicht viele Länder unberührt gelassen. Und in Asien sind die Erinnerungen an den Zweiten Weltkrieg noch gegenwärtig, vielleicht sogar noch mehr als in Europa. Denn in Ländern wie Südkorea oder Südostasien herrscht das Gefühl vor, dass sich Japan nicht wirklich mit dem Erbe des Krieges auseinandergesetzt hat. Die Wunden dort heilen noch langsamer. In den Niederlanden gibt es heute keine ernsthaften Vorbehalte gegenüber Deutschland mehr. In Südkorea und China gibt es dagegen noch eine Menge Vorbehalte gegen Japan. Diese Emotionen sind da, und sie werden manchmal auch für politische Zwecke angefacht.
In den Niederlanden war die Abneigung gegen Deutsche nach dem dem Zweiten Weltkrieg sehr ausgeprägt.
Gegen Deutschland zu sein wurde nach dem Zweiten Weltkrieg ein Teil der niederländischen Identität – so, wie es bis heute Teil der polnischen Identität ist, gegen Russland zu sein. Aber in den Niederlanden ist das jetzt Vergangenheit. Junge Leute sind heute nicht mehr so antideutsch eingestellt, wie es meine Generation noch war. Berlin gilt als cool, und es macht niemandem mehr etwas aus, wenn Deutschland im Fußball gewinnt. Uns dagegen machte das damals sehr viel aus: wir sahen in Lothar Matthäus einen Wiedergänger der Nazis (lacht).
Das ist heute vorbei?
Heute muss man neue Dinge finden, um seine Identität zu artikulieren. Das ist heute viel komplizierter. Da kommen dann etwa die Muslime ins Spiel.
Die Niederlande waren im Krieg ein Opfer der Deutschen. Hat das verhindert, sich mit der eigenen kolonialen Vergangenheit auseinanderzusetzen?
Jede Nation hat ihre Mythen, die es ihnen erlauben, sich stolz zu fühlen. In manchen Fällen, wie in China, ist es ihre alte Zivilisation. In anderen, wie in Frankreich, sind es kulturelle Leistungen. In den Niederlanden ist es das Gefühl, anderen Nationen moralisch überlegen zu sein. Das ist ein sehr protestantisches Konzept. Und es macht es schwerer, sich den dunklen Kapiteln der eigenen Geschichte zu stellen.
Ist die Debatte um den „Zwarte Piet“ dafür ein Symptom? Diese Figur mit Wulstlippen und krausem Haar begleitet in Holland traditionell den Nikolaus. Viele Niederländer wehren sich gegen die Vorstellung, er könnte etwas mit dem Kolonialismus zu tun haben.
Dabei hat es alles mit Kolonialismus zu tun! Konservative sagen immer: aber wir lieben den Zwarte Piet, er ist so eine positive Figur! Das stimmt, aber er knüpft auch an das Stereotyp vom „Naturvolk“ an. Er tanzt, macht lustige Grimassen und ist immer fröhlich. Diese Vorstellung vom „Naturvolk“ hat auch in Deutschland bis weit nach dem Zweiten Weltkrieg überdauert. Klar wurden diese Menschen bewundert – aber aus den falschen Gründen.
Soll man den Zwarte Piet abschaffen oder reformieren?
Ich bin ganz auf der Seite derjenigen, die sagen, dass das eine altmodische Tradition ist, die in der heutigen Welt keinen Platz mehr haben sollte. Er ruft zu viele schlechte Assoziationen hervor. Es ist auch keine sehr alte Tradition: sie stammt, wie so vieles, aus dem 19. Jahrhundert. Denn wenn sie sich Abbildungen des heiligen St. Nikolaus aus den 17. Jahrhunderts anschauen, dann finden sie dort keinen „Zwarte Piet“.
Dennoch hängen viele Niederländer am „Zwarte Piet“?
Zwischen den Städten und den Provinzen gibt es eine Kluft. Aber in den großen Städten ist der „Zwarte Piet“ weitgehend abgeschafft worden.
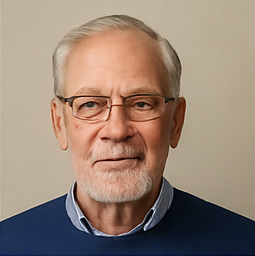 Hans Schneider
Hans Schneider
Source of the news: fr.de